
Soziale Arbeit im Migrationsbereich
Soziale Arbeit im Migrationsbereich
Die Soziale Arbeit tut sich schwer damit, ihre Arbeit als politisch zu betrachten. Wenn es um das Thema Migration und Integration geht, kann jedoch auch die Soziale Arbeit ihre vermeintlich neutrale integrierende Rolle nicht mehr unreflektiert ausüben. Denn nach wie vor ist es eine Realität, dass Migration nicht selten mit mangelnder Chancengerechtigkeit einhergeht und damit ein Risikofaktor ist für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft.
Wir starten diesen Schwerpunkt mit Artikel von Gianni d’Amato und Claudio Bolzmann zum Stand der Integrationspolitik in der Schweiz und zum Umgang mit Ausländerinnen, auch aber nicht nur in der Sozialen Arbeit. Ergänzende Anmerkungen zur Integrationspolitik im Zeichen der vieldiskutierten Integrationsvereinbarungen vom Schaffhauser Integrationsdelegierten Kurt Zubler runden diesen Einstieg ab.
Luzia Jurt diskutiert anschliessend Voraussetzungen für eine migrationssensible Soziale Arbeit, welche nicht versucht, Differenzen auszutarieren, sondern Differenzen reflektiert. Elisa Streuli, Integrationsbeauftragte der Stadt Basel, nimmt im Interview zur Situation in Basel Stellung und erläutert die Strategie der Willkommenskultur. Sehr praktisch illustriert Umberto Castra an einem Beispiel aus der Suchtberatung in Bern, wie die Arbeit mit KlientInnen mit Migrationshintergrund aussehen könnte, wenn die Migrationsbevölkerung am Prozess beteiligt wird. Im politischen Rampenlicht im Kontext Integration steht die frühe Förderung. Frank Will gibt einen Überblick und weist auf einige migrationsspezifische Stolpersteine hin.
Sechs kurze Portraits von vielversprechenden Projekten und ein Tagungsbericht zur Tagung „Alter und Migration“ der Pro Senectute illustrieren über den Schwerpunkt verteilt, wie vielfältig die Interventionen der Sozialen Arbeit im Kontext von Integration und Migration heute bereits sind.

Berufsethik
Berufsethik
AvenirSocial hat einen neuen Berufskodex für die Soziale Arbeit in der Schweiz. Dies ist für uns Anlass, den Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe dem Thema Berufsethik zu widmen. Denn im Berufskodex werden die ethischen Richtlinien für das moralische Handeln in der Sozialen Arbeit dargelegt.
Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass der Berufskodex uns Professionellen der Sozialen Arbeit Orientierung und Hilfestellung und somit Sicherheit in der täglichen Arbeit bietet. Oft sind wir gefordert, richtiges von falschem Handeln zu unterscheiden. Immer wieder werden wir im Alltag mit Dilemmata konfrontiert. Hier kann uns der Berufskodex Orientierung bieten. Er kann uns aber nicht von einer intensiven Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Fragestellungen befreien. Wir sind gefordert, unser Handeln und unsere Haltungen immer wieder zu hinterfragen und zu überprüfen. Dabei kann uns die kollegiale Ethikberatung in der Praxis unterstützen.
Der Berufskodex soll also den ethischen Diskurs zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den Organisationen des Sozialwesens sowie anderen Disziplinen und Professionen anregen. Er ist ein Instrument zur ethischen Begründung der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, die in besonderer Weise verletzbar oder benachteiligt sind. Nicht zuletzt soll er auch zur Bildung einer starken Berufsidentität beitragen und das Selbstverständnis der Professionen stärken.
In den verschiedenen Texten dieses Themenschwerpunktes gehen die Autorinnen und Autoren den Fragen nach, ob die Professionelle Soziale Arbeit eine Ethik braucht und über welches ethische Grundwissen wir verfügen sollten. Dabei wird immer wieder explizit auf den Inhalt des neuen Berufskodexes Bezug genommen. Ethische Reflexionskompetenz ist ein wesentlicher Teil des professionellen Handelns. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Anregung zum ethischen Reflektieren und zur Initiierung kollegialer Ethikberatung in der Praxis. Möge der Berufskodex zu einem wichtigen Instrument ethischer Orientierung werden!

Sozialhilfe
Sozialhilfe
Während in der Fachpresse und in den Publikationen der wichtigsten Sozialhilfeakteure seit einigen Jahren die strukturellen Ursachen für den Sozialhilfebezug in den Vordergrund rücken, bildet in der öffentlichen Wahrnehmung das individuelle Verschulden nach wie vor die Hauptursache für einen Sozialhilfebezug. Insbesondere SKOS und Städteinitiative Sozialpolitik propagieren in zahlreichen Stellungnahmen, Positionspapieren und Absichtserklärungen, dass die Sozialhilfe ihren Integrationsauftrag nicht nur auf die berufliche Integration beschränken, sondern verstärkt auch auf die soziale Integration ausweiten müsse. Damit ist die Einsicht verbunden, dass neben der individuellen Lebensgestaltung vor allem sozialräumliche und gesellschaftliche Faktoren massgebend dafür sind, ob eine Person bedürftig wird oder nicht.
In den Medien wird dagegen mit stark verengter Sichtweise weiterhin darüber berichtet, mit welchen Mitteln Sozialhilfebezüger auf Teufel komm raus in den das Arbeitsleben reintegriert, „Integrationsunwillige“ vom Sozialhilfebezug abgehalten sowie „Sozialschmarotzer“ entlarvt und bestraft werden können. Eine differenzierte Darstellung gegenüber der breiten Öffentlichkeit ist, so scheint es, politisch nach wie vor nicht opportun.
So bewegen sich die Sozialarbeitenden in einem dauerhaften Spannungsfeld zwischen ihren eigenen professionellen Ansprüchen an ihre Arbeit mit Sozialhilfebezügern auf der einen und den Wahrnehmungen und Forderungen der breiten Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Die Verantwortlichen der Sozialdienste, welche in der Regel ihre Tätigkeiten gegenüber der Bevölkerung darlegen müssen, sind dieser Gratwanderung besonders ausgesetzt. Nachdem Dorotee Guggisberg aus Sicht der SKOS die aktuellen Tendenzen der Sozialhilfe absteckt, beschreibt Brigitte Hunziker aus Sicht des Berufsverbandes avenir social die Zwickmühle, die die Rolle der Sozialarbeitenden in der Sozialhilfe prägt. In den weiteren Beiträgen analysieren Forscher/innen die Situation verschiedener Klientengruppen der Sozialhilfe. Dieter Haller analysiert dabei die Situation der von einer Mehrfachproblematik belasteten Personen und zieht daraus notwendige Konsequenzen für die Sozialarbeit. Insgesamt wird deutlich, welch unterschiedliche Anforderungen die jeweiligen Gruppen an die Sozialarbeitenden stellen bzw. welch ausdifferenziertes Instrumentarium der Professionellen diese komplexe Ausgangslage erfordert.
Schliesslich wird am Beispiel des Passage-Modells der Stadt Winterthur die Gratwanderung zwischen Inklusion und Exklusion verdeutlicht, wenn Ernst Schedler, Leiter des Sozialdienstes in Winterthur, und der Soziologe Kurt Wyss ihre sehr unterschiedlichen Positionen zur obligatorischen einmonatigen „Arbeitsgegenleistung als Voraussetzung für den Bezug von Sozialhilfe“ darlegen. Die damit eingeleitete Debatte zu Sinn oder Unsinn von Zwang bzw. Verpflichtung zu einer Gegenleistung in der Sozialhilfe ist eine Einladung an alle Leser/innen, diese wichtige Diskussion (wieder) aufzunehmen. Dies umso mehr, als nach der Stadt Winterthur nun auch die drei grössten Deutschschweizer Städte ein ähnliches Modell in die Praxis umgesetzt haben. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und somit auf einen offenen Diskurs um eine der zentralen Fragen der Sozialen Arbeit.
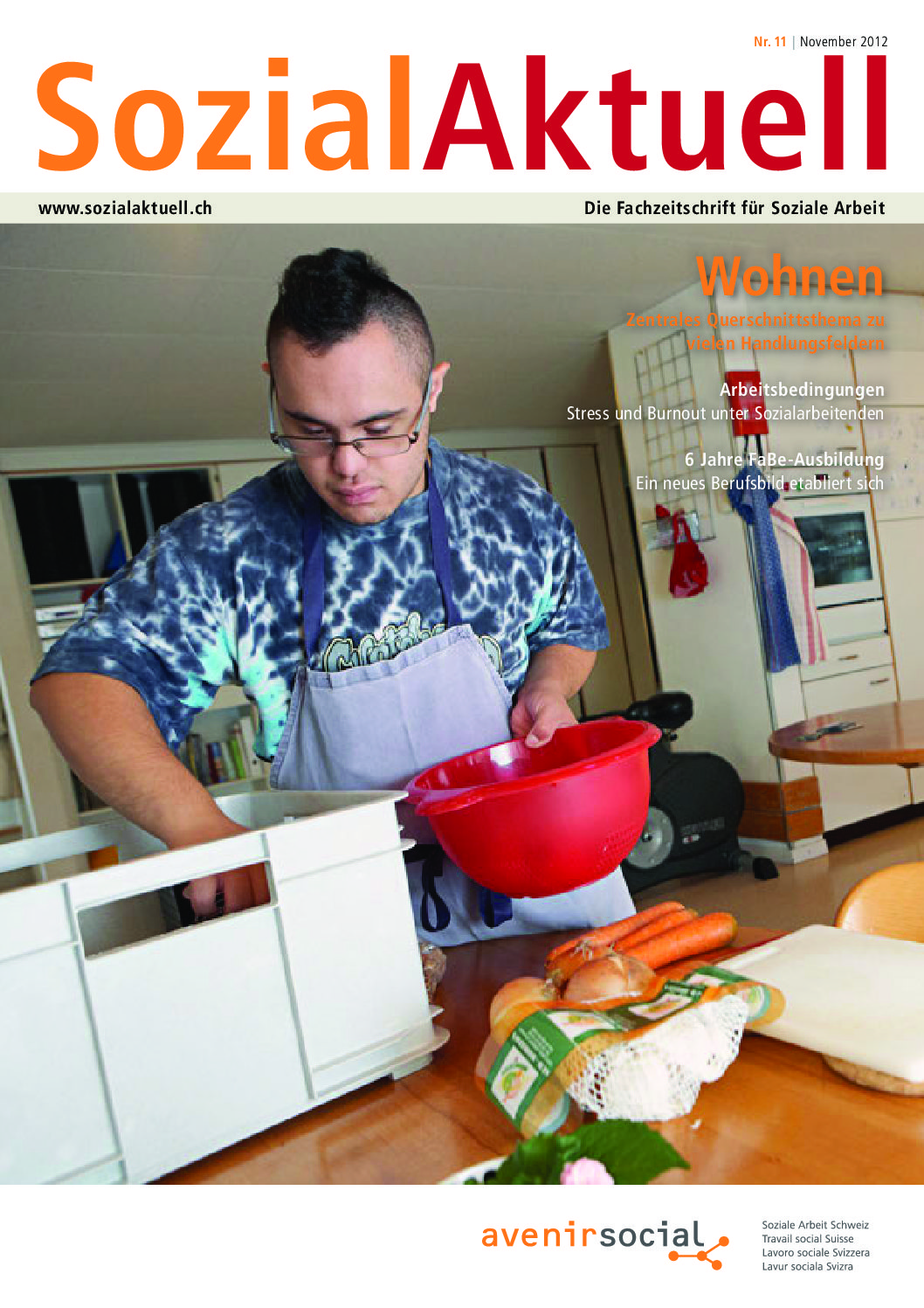
Wohnen
Wohnen
Soziales Wohnen
heutzutage sind wir alle angehalten, unsere Kompetenzen ständig weiter zu entwickeln. Wir möchten Sie deshalb einladen, sich mit einigen zentralen Fragen bezüglich Kompetenzen und Lebenspraxis auseinanderzusetzen: Wie ist Ihr Kontakt zur Nachbarschaft? Stellen Sie den Müll zur richtigen Zeit auf die Strasse (vor allem nicht zu früh)? Bezahlen Sie die Miete regelmässig und rechtzeitig? Haben Sie den Rasen gemäht?
Gewohnt, uns mit Selbst- und Kommunikationskompetenzen, zu beschäftigen, nehmen wir vielleicht die Frage nach Rasenmäher und Kehrichtmarken nicht so ernst. Über Wohnen redet man nicht, das tut man einfach. Wer aber auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in guter Gegend ist oder unter Strassenlärm oder aufdringlichen Nachbarn leidet, sieht das schnell einmal nicht mehr so salopp. Da wird Wohnen zum Thema.
Für einen Grossteil unserer KlientInnen dreht sich sehr viel, manchmal fast alles, um das Wohnen. Sie wohnen an einem Wohnort namens Wohnheim oder betreutes Wohnen, andere werden unsere KlientInnen, weil sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können oder weil sie fern von hier Wohnung und alles hinter sich lassen mussten. Andere MitbürgerInnen haben das Wohnen in langen Jahren der Haft verlernt oder werden „Wohnungslose“ genannt – fast eine Garantie, einmal mit VertreterInnen der Sozialen Arbeit in Berührung zu kommen.
Es ist deutlich: Ein „Wohnheft“ – das erste, seit es SozialAktuell gibt – macht Sinn. Die Texte ermöglichen einen Einblick in Fragen und Probleme, die sich zum Thema Wohnen stellen: für die Direktbetroffenen, für die unmittelbar Begleitenden und aus grösserer Distanz. Darüber hinaus geben sie uns Hinweise auf bereits erprobte und auf kommende Lösungen.
Martin Waser, der Vorsteher des Zürcher Sozialdepartementes, und Christoph Mattes erörtern das Thema aus einer gesamtgesellschaftlichen bzw. politischen Perspektive. Ulrich Otto und Silvia Beck bringen uns in ihrem Text den Ansatz des generationenübergreifenden Wohnens näher. Mehrere Beiträge befassen sich mit zwei wesentlichen Fragen zum stationären Wohnen, nämlich der Lebensqualität von KlientInnen und den Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen. Diese Beiträge werden durch eine Reportage von Simone Moser aus der Notschlafstelle in Thun ergänzt. Schliesslich seien auch der Text von Jeanine Wirz von der Asylorganisation Zürich und das Interview mit Annalis Dürr von der Stiftung Domicil erwähnt: sie erlauben einen Einblick in den alltäglichen „Nahkampf“ rund um das Wohnen.
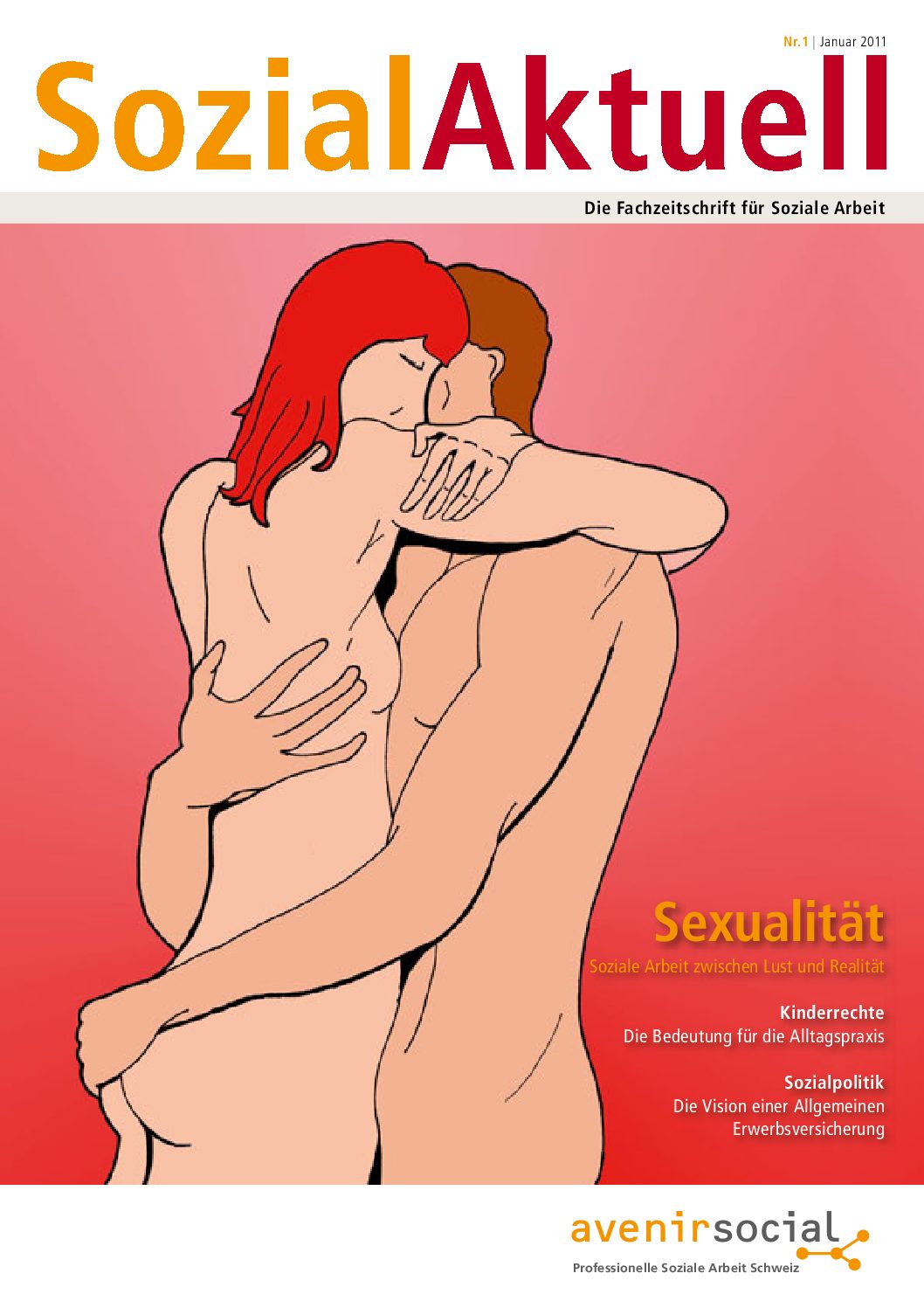
Sexualität
Sexualität
Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass Sozial Aktuell der Sexualität im Kontext Sozialer Arbeit ein ganzes Heft gewidmet hat (vgl. Sozial Aktuell, Nr. 21, Dezember 2002). Dazwischen gab es themenbezogene Hefte zu HIV/Aids (2004), Prävention sexueller Gewalt (2005) und
Tabus – auch in der Sozialen Arbeit. Über Liebe und Missbrauch (2006).
Wir fanden, dass die Zeit reif ist, ein neues Themenheft Sexualität und Soziale Arbeit zu gestalten, um im Sinne einer Bestandesaufnahme die aktuellen Entwicklungen in Praxis, Politik und Wissenschaft abzubilden sowie anstehende Aufgaben für die Zukunft zu skizzieren.
Gegenwärtig wird der öffentliche Diskurs über Sexualität durch zwei einander widersprechende Grundhaltungen bestimmt: Auf der einen Seite sind die Individuen aufgefordert, jederzeit Identitätsarbeit zu leisten und ihre Sexualität frei, selbstbestimmt und einvernehmlich zu leben. Auf der anderen Seite scheint es heute populär zu sein, bei Medienmeldungen über sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt immer rigidere Sexualstrafnormen einzufordern. Nach dem amerikanischen Soziologen John H. Gagnon schafft die Art von Sexualität, an die die Mitglieder einer Gesellschaft glauben, die Art von Sexualität, die sie erhalten (vgl. Human sexualities, 1977). Die gegenwärtig gültige Sexualmoral – die so genannte Verhandlungsmoral – erfordert starke Sozial- und Selbstkompetenzen, da der moralische Massstab in sexuellen Beziehungen deren einvernehmliche Aushandlung ist. Dieses Moralkonzept entspricht einer mündigen demokratischen Bürgergesellschaft, deren Mitglieder sich als Gestaltende ihrer selbst wahrnehmen und vernunftgeleitet ihre Sexualität und Partnerschaft leben. Die freie Entfaltung der individuellen Persönlichkeit – insbesondere in Sexualität und Beziehungsgestaltung – ist ein hohes, schützenswertes Gut, dessen Einschränkung nicht ohne weiteres hingenommen werden sollte. Die Geschichte der Sexualität kennt viele solche Versuche beschränkender Einflussnahme, deren Auswirkungen stets negativ waren; für die Einzelnen wie für die Gesellschaft. Es liegt bei der Sozialen Arbeit, inwiefern sie sich an immer rigideren Aufsichts- und Sanktionsmassnahmen beteiligt bzw. instrumentalisieren lässt – wie schon einmal in Form der staatlichen Fürsorge bis weit ins 20. Jahrhundert hinein oder ihre gegenwärtige Aufgabe viel eher auf dem Hintergrund von empirischen Forschungsergebnissen darin sieht, mit Programmen der Bildung und Beratung Befähigungsgerechtigkeit zu Themen der Sexualität und Partnerschaft herzustellen.
Das vorliegende Heft richtet den Aufmerksamkeitsfokus auf aktuelle gesellschaftliche, soziale und berufspolitische Herausforderungen. Unsere Autorinnen und Autoren berichten ohne aufgeregten Alarmismus über Themen und Fakten. Viel Spass beim Lesen!

Soziale Arbeit im unfreiwilligen Kontext
Soziale Arbeit im unfreiwilligen Kontext
Soziale Arbeit im unfreiwilligen Kontext
Unfreiwilligkeit, widrige Umstände, Zwangskontext, Pflichtklientschaft: unsere Autor/-innen des vorliegenden Themenschwerpunktes verwenden unterschiedliche Begriffe. Faktum ist, dass Soziale Arbeit seine Wurzeln in der Armenfürsorge und in der Heimerziehung hat. Beide Bereiche waren nie Orte der Freiwilligkeit.
Unsere These ist: Es ist auch heute ein konstituierendes Merkmal von Sozialer Arbeit, dass sie im Wesentlichen in Institutionen und Feldern stattfindet, zu denen der Zugang und die Unterstützung der Klient/-innen aufgrund hoheitlicher Machtausübung und nicht selten auch mit der Androhung von Sanktionen erfolgt. Soziale Arbeit hat sich im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung und seiner Professionalisierung zunehmend kritisch damit auseinandergesetzt: Wie kann sie sich als nicht bloss ausführendes Organ staatlicher Ordnung verstehen? Wie kann in diesen Kontexten sinnvolle und hilfreiche Arbeit stattfinden, welche die Selbstbestimmung und die Entscheidungsmöglichkeiten der Klient/-innen vergrössert oder zumindest erhält?
Zu beobachten sind auch vielfältige Absetzbewegungen: Kolleg/-innen aus Praxis und Theorie versuchen diesen zentralen Fragen explizit oder auch heimlich auszuweichen und suchen Themen und Arbeit ausserhalb der klassischen Felder. Optionen gibt es viele im wachsenden Beratungsmarkt: von Spezialisierung über Prävention bis hin zu Supervision und Mediation. Wir wollen nicht alles schlecht reden. Auffällig ist jedoch auch, dass dabei häufig die Berufsbezeichnung Sozialarbeiter/-in oder Sozialpädagog/-in rasch auf der Strecke bleibt.
SozialAktuell stellt sich mit dieser Nummer erneut dieser Auseinandersetzung. Erwünscht waren grundsätzlich bejahende, aber auch kritische und provozierende Positionen. Dabei sind wir auf Schwierigkeiten gestossen, z.B. bei der Suche nach Fachkolleg/-innen aus den Hochschulen, die bereit waren sich dazu zu äussern. Dank gebührt deshalb Gisela Hauss, Werner Stotz und Johannes Schleicher für ihre Beiträge. Praxisnahe Berufskolleg/-innen sagten wesentlich spontaner zu. Es wirkt beispielhaft und ermutigend, wenn Kolleg/-innen ihre Praxis darstellen und kritisch reflektieren.

Neue Medien
Neue Medien
Neue Medien
Längst hat sich das digitale Zeitalter im täglichen Handeln und in der Alltagssprache niedergeschlagen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, googeln wir einfach die benötigten Informationen. Neuigkeiten, die Spatzen früher von den Dächern pfiffen, twitternwir heute unseren followers. Freunde fürs Leben gibt es nicht mehr nur im Verein, sondern auch digital auf Facebook. Geplaudert wird weiterhin im Treppenhaus und am Stammtisch, vermehrt jedoch auch via Skypeund instantmessaging. Wichtige Momente und fotogene Sujets werden mit der Handy-Kamera dokumentiert und sogleich via App auf dem Smartphone oder Tablet Computer als SMSoder Emailmit den Liebsten geteilt, auf welchem Fleck der Erde sich diese auch gerade befinden mögen.
Egal ob Sie zur Generation der digital nativesgehören und die digitalen Medien selbstverständlich und in verschiedenen Lebensbereichen nutzen oder ob Sie ein mehr oder weniger versierter digital immigrantsind: Die Neuen Medien beschäftigen und erregen die Gemüter, im positiven Sinne wie auch als Irritation und Ärgernis.
In dieser Ausgabe von SozialAktuell beschäftigen wir uns für einmal nicht mit dem Suchtpotential der Neuen Medien oder ihren Auswirkungen auf den Alltag von jungen und älteren Menschen. Vielmehr möchten wir ihr Potential als Werkzeug oder Instrument für die Soziale Arbeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen. Neue Organisationsformen, neue Kommunikationswege auch in der Beratung und ein komplexes Informationsmanagement sind nur einige Beispiele für mögliche Anwendungsbereiche der Neuen Medien im praktischen Alltag der Sozialen Arbeit.
«Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem als Nagel», sagt Paul Watzlawick.Dieser Schwerpunkt möchte die Diskussion über die Potentiale und Grenzen der digitalen Welt im Hinblick auf die Soziale Arbeit anregen.
Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre.
15

Frauen in der Sozialen Arbeit
Frauen in der Sozialen Arbeit
Frauen und Soziale Arbeit
Die vorliegende Ausgabeentstand aus der Idee, das Feld der Frauen innerhalb der Sozialen Arbeit zu beleuchten. Wir wollten explizit kein Gleichstellungsheft produzieren, aus der festen Überzeugung heraus, dass das Thema Frauenzu trennen sei von dem der Gleichstellung. Doch die Realität belehrte uns eines anderen: Sobald das Thema Frauen fällt, fällt auch das Thema Gleichstellung. Und das nicht nur in unseren eigenen Köpfen, sondern auch bei den Fachpersonen, die gerne etwas zum Thema Frauen und Soziale Arbeit publizieren wollten.
Also doch ein Gleichstellungsheft. Also doch wieder Berichte darüber, dass Frauen noch immer weniger verdienen für dieselbe Arbeit, dass Betreuungsarbeit noch immer abgewertet wird und dass in den oberen Etagen noch immer die Frauen fehlen. Davon haben wir doch endlich mal genug gehört…, denken wir. Nur, warum fassen diese Erkenntnisse nicht in der Praxis? Warum nehmen Professionelle die Geschlechterordnung noch immer kaum wahr und reproduzieren in Beratungssituationen nach wie vor geschlechterbedingte Differenzen? Und zwar nicht nur die Männer, sondern genauso die Frauen?
Wer sind denn überhaupt dieFrauender Sozialen Arbeit? Welche Merkmale greifen wir heraus, um sie zu identifizieren? Gibt es bei genauerer Betrachtung über das schwesterlich-solidarische Wir-Gefühlhinaus etwas, in dem das eigene Ich aufgehen kann?
Und dürfenwir Frauen uns denn überhaupt darüber beklagen, dass wir weniger Führungspositionen besetzen, wenn für Frauen die Arbeit am eigenen Selbst im Mittelpunkt steht? Wenn sie lieber einen persönlichen sinnvollen Werdegang kreieren und ihnen dabei die gesellschaftliche Position nicht so wichtig ist?
Das Geschlecht ist allgegenwärtig – auch ohne Benennung der Unterschiede, auch mit dem Fokus auf die Gemeinsamkeiten. Es strukturiert unseren Alltag und unsere Arbeit so grundlegend und ist gleichzeitig so schwer fassbar.
Wir laden Sie ein, sich durch dieses unaufgeräumte Thema hindurch zu lesen und Fantasien zu entwickeln, wie es sich vielleicht etwas aufräumen liesse.

Diskriminierung
Diskriminierung
Diskriminierung
Diskriminierung findet im Privaten, in der Öffentlichkeit, im Kleinen wie im Grossen statt – obwohl die europäische Menschenrechtskonventionin Art. 14verbietet, die Rechte der Menschen wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status einzuschränken. Diskriminierung findet überall statt – auch in der Sozialen Arbeit. Dieser Schwerpunkt befasst sich insbesondere mit den Themen Geschlecht, Rassismus, kulturelle und soziale Differenzen. Das Thema der Behinderung haben wir – im Wissen, dass auch dort Diskriminierung stattfindet – aus Platzgründen bewusst aus diesem Schwerpunkt weggelassen. Wir danken allen Autoren und Autorinnen für ihre fachkundigen Beiträge.
Auch wir sind im Alltag – und eben auch in der Sozialen Arbeit – nicht gefeit, diskriminierend zu urteilen und zu handeln. Denn wo fängt Diskriminierung an? Wir sollten uns immer wieder dabei beobachten, wo wir selber durch sogenanntes « Schubladisieren » mit Vorurteilen unseren professionellen wie privaten Alltag bestreiten. Und deshalb nicht offen und ohne bereits vorgefasste Meinung auf andere Menschen zugehen und begegnen. Zur Zeit scheint insbesondere die Fokussierung auf die sogenannte « kulturelle Differenz » en vogue zu sein.
Sobald wir mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten bei unserem Gegenüber feststellen, wenn also das « Andere » dominiert, ist der Boden für allfällige Diskriminierung bereits vorhanden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Achtsamkeit und ein vorurteilfreies Lesen.

Frühpädagogik
Frühpädagogik
Frühpädagogik – zwischen kindgerechter Förderung und familienentlastender Sozialpolitik
Den Bildungsbegriff im Zusammenhang mit frühkindlicher Förderung zu verwenden, löst in vielen Kreisen von stirnrunzelndem Unverständnis bis zum Abwinken mit dem schönen Satz “Lasst Kinder doch Kinder sein“ eher ablehnende Reaktionen aus. Bildungspolitisch beginnt die frühe Förderung von Kindern in der Deutschschweiz erst ab dem 4. Lebensjahr mit Eintritt in den 2jährigen Kindergarten. Und auch das erst verbindlich nach dem Inkrafttreten desHarmos-Konkordates ab 2015, wobei in vielen Kantonen Eltern auf Gesuch hin ihre Kinder nicht in den bedrohlichen Kindergarten schicken müssen. Weitergehende Reformbemühungen wie die Zusammenführung von Kindergarten und den ersten Schuljahren als Grund- bzw. Basisstufe oder gar die im Ausland übliche organisatorische und pädagogische Zusammenführung von Kindergarten und Kita sind politisch entweder gescheitert oder werden gar nicht erst zu denken versucht.
FrüheFörderung von Kindern ab Geburt wird meist nur dann unterstützt (bzw. sogar für obligatorisch erklärt, wie im neuen Integrationsgesetz von Basel-Stadt), wenn sie sozial- oder integrationspolitisch begründet wird. Eine pädagogische Begründung, Kinder so früh wie möglich spielerisch zu fördern, wird jedoch kaum je vorgebracht.Genau dies will der nationale Orientierungsplan, der in wenigen Tagen offiziell vorgestellt wird und der (wie es Miriam Wetter, Geschäftsführerin von Kinderbetreuung Schweiz, in ihrem Beitrag auf Seite 12 betont)geradedank dieser Grundausrichtung sicherstellen will, dass Kinder Kinder sein können. Das Kindswohl ist nämlich in der öffentlichen Debatte um Rahmenbedingungen der frühkindlichen Betreuung und Bildung meist nur am Rande ein Thema undwird reflexartig mit der familiären Betreuung gleichgesetzt. Die unselige SVP-Kampagne gegen staatliche Bildung allgemein und frühkindliche im Besonderen fordert da offensichtlich auch weit in sonst bildungsfreundliche Kreise hinein ihren Tribut.
Neben einem kinderfreundlichen Bildungsansatz (Beitrag Seite 16) sind natürlich die fachlichen und personellen Rahmenbedingungen durchaus von Bedeutung, da der Ausbau der Betreuungsplätze und die Ausbildung der entsprechenden Fachleute beträchtliche gesellschaftliche Ressourcen erfordert. Ein rein quantitativer Ausbau führt nämlich zur grossen Gefahr der Vernachlässigung des qualitativen Ausbaus, wie er von verschiedenen Untersuchungen in der Schweiz und Deutschland zu Recht gefordert wird (Beitrag Seite xy). Ein Abbild dieses Spannungsbereiches geben die beiden Interviews, welche wir in der Wandelhalle des Bundeshauses mit SP- Nationalrätin Hildegard Fässler (Präsidentin KitaS) und FDP-Nationalrat Otto Ineichen (Stiftung Speranza, Stiftung Wirtschaft + Familie) geführt haben. Interessant ist dabei unter anderem die Frage: Wie kann der wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in den nächsten Jahren massiv erhöht werden? Braucht es dazu „Billig-Krippen“, geführt von Frauen, die nach ihrer eigenen Babypause gestützt auf eine Schmalspurausbildung als Ich-AG wieder ins Berufsleben einsteigen, oder ist eine koordinierte staatliche Initiative unter Einbezug der Schul- und Kindergarteninfrastruktur der erfolgversprechende Weg?SA_5:2012

Sozialpsychiatrie
Sozialpsychiatrie
Vom Umgang der Sozialen Arbeit mit psychischen Erkrankungen
Das Bundesamt für Gesundheit BAG gibt an, dass jährlich 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung an einer diagnostizierbaren psychischen Störung leiden. Die Anzahl psychisch kranker IV-RentenbezügerInnen stieg in den letzten Jahren kontinuierlich und stark überproportional an. Das Fazit des BAG: Psychische Störungen sind weit verbreitet und führen zu grossen individuellen und sozialen Belastungen. Das mediale Fazit der Weltwoche: Es droht die Invalidisierung der Gesellschaft.
Die Soziale Arbeit spürt diese gesellschaftlichen Tendenzen sehr direkt. Sowohl in der Sozialhilfe als auch in ambulanten und stationären sozialen Einrichtungen stellen Sozialarbeitende fest, dass sich ihre Klientel verändert. Sie sehen sich immer öfter mit psychisch beeinträchtigten KlientInnen konfrontiert.
Verschlechtert sich also die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft? Studien streiten sich, ob man von einem zahlenmässigen Anstieg der psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen ausgehen kann. Es ist jedoch bekannt – und dies interessiert wiederum die Soziale Arbeit –, dass die steigende Belastung auf dem Arbeitsmarkt und zusätzliche Stressoren wie z.B. schwierige Migrations- oder Fluchtgeschichten, Arbeitslosigkeit, mangelnde soziale Kontakte oder Armut die psychischen Belastungen verstärken.
Entsprechend liegt der Auftrag der Sozialen Arbeit in der Arbeit mit psychisch kranken oder beeinträchtigten KlientInnen darin, diese in der Alltagsbewältigung zu unterstützen und soziale Problemlagen gemeinsam anzugehen. Welches die Herausforderungen dabei sind und welche Rolle die Soziale Arbeit im Kontext der Sozialpsychiatrie einnimmt, damit beschäftigt sich die vorliegende Ausgabe von SozialAktuell und insbesondere Ruth Steiner in ihrem Einführungsartikel. Daniel R. White und Gert Hellerich werfen einen prüfenden Blick auf den Umgang der normativ ausgerichteten Sozialen Arbeit mit psychischen Abweichungen. Eine Reportage und ein Fachbeitrag zum Projekt Tagesstätte 65+ und ein Interview mit dem Sozialpädagogen Frank Hellerich zeigen, wie die sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen in der Praxis aussehen kann. Einen Appell von Betroffenen an die Soziale Arbeit haben Christoph Lüthy von Pro Mente Sana und Elsy B. Moser verfasst. Der Schwerpunkt wird ergänzt von einem kritischen Beitrag von Niklas Bär zur 6. IV-Revision, die gerade für psychisch beeinträchtigte Menschen spürbare Konsequenzen hat.
Die Soziale Arbeit hat es nicht immer einfach im Feld der Psychiatrie. Als ungefestigte Profession trifft sie auf eine selbstbewusste Medizin, was dazu führt, dass der Sozialen Arbeit im therapeutischen Prozess oft lediglich eine Hilfsfunktion zugeschrieben wird, wie Cornelia Rüegger diagnostiziert. Die Autorin zeigt auf, welche Rolle die Soziale Arbeit als selbstbewusste Spezialistin für die soziale Dimension der psychischen Erkrankung innerhalb der Psychiatrie übernehmen könnte.SA_4:2012

Soziale Arbeit in Familien
Soziale Arbeit in Familien
Soziale Arbeit in der Familie
Viele Professionelle der Sozialen Arbeit haben in ihrer Arbeit direkt oder indirekt mit Familien zu tun – Soziale Arbeit mit Familien ist ein relevantes Thema. Letztmals hat sich SozialAktuell vor zwei Jahren damit befasst, im Rahmen des Schwerpunkts zur familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im März 2010. Für uns Anlass genug, erneut einen Schwerpunkt zum Thema zu realisieren.
Ursprünglich hatten wir die Idee, in dieser Ausgabe den Fokus auf Familien mit ihren vielfältigen Facetten zu richten – mit und ohne Kinder, im höheren Alter, mit dem Blick auf die Generationenfrage und überhaupt einfach mal quergedacht –, doch das Erstkonzept überzeugte nicht. Das geneigte Fachpublikum – Sie also – wären möglicherweise nicht zufrieden gewesen. Wir gingen deshalb über die Bücher und blieben am Klassischen und seiner Weiterentwicklung hängen: Soziale Arbeit in der Familie. Welche neue Ideen gibt es hier, wie werden sie umgesetzt?
Im Fokus dieses Schwerpunkts steht der Ansatz der aufsuchenden Familienarbeit – die sozialpädagogische Familienhilfe. Gerade die ambulante sozialpädagogische Familienhilfe scheint uns derzeit sehr im Trend zu liegen: Mit ihr sollen teure langjährige Fremdplatzierungen vermieden und statt dessen die Ressourcen der Familien gestärkt werden.
Nach einem Einstiegsartikel erhalten Sie Einblicke in die Arbeit des Elternnotrufes, in die Praxis der sozialpädagogischen Familienbegleitung und – am Beispiel des Familien-Supports in Bern-Brünnen – in die Elternarbeit aus dem stationären Kontext heraus. Im Weiteren geht es um die oft sehr schwierige Aufgabe von Beiständinnen und Beiständinnen im Zusammenhang mit Besuchsrechtsstreitigkeiten, und abschliessend werden die zwei Frühförderprogramme zeppelin und schritt:weise vorgestellt. Gespickt ist der Themenschwerpunkt mit den einen oder anderen Zusatzinformationen.
Wir wünschen Ihnen tiefe Einblicke in ein historisches, sich beständig weiterentwickelndes Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit – und viele neue Erkenntnisse.